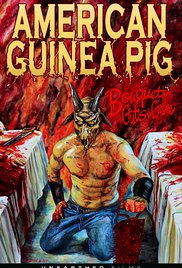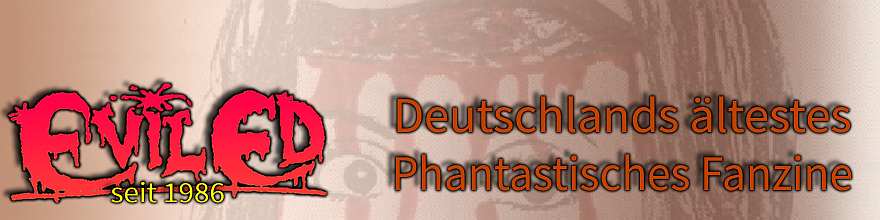|
(USA 2015) Regie / FX / Drehbuch (haha!): Stephen Biro Darsteller (rofl!): Ashley Lynn Caputo (echt jetzt?) und Cayt Feinics als Opfer, Jim Van Bebber als Gaststar (warum?)
Die “Ginī piggu“-Reihe (und hier insbesondere „Ginī piggu 2: chiniku no hana“) dürfte vermutlich dem am nächsten kommen, was Kulturkonservative unter der Rubrik „Gewaltvideo“ zusammenfassen: ausufernde Gore-Effekte bei gleichzeitiger Nullhandlung in einem schmuddeligen Fake-Snuff-Ambiente. Unter streng ökonomischem Blickwinkel also das ideale Produkt. 
Billig herstellbar, auch bei Distributionsbeschränkungen aufgrund der Mundpropaganda leicht zu vermarkten, letztlich also Filme, die bei minimalstem finanziellen und kreativem Aufwand maximalen Gewinn erzielen können. Diesem Umstand dürften wir es auch zu verdanken haben, dass sich Stephen Biro, der über das Label Unearthed Films die „Ginī piggu“-Reihe und andere hauptsächlich aus Asien stammende Exploitationfilme in den Vereinigten Staaten veröffentlichte, an einer amerikanischen Fortschreibung dieser berüchtigten und in Deutschland selbstverständlich durch Indizierung und Verbot noch zusätzlich geadelten Serie versuchte. Und man muss anerkennen, dass ihm dies in jeder Hinsicht gelungen ist. a) positiv: stilistisch fügt sich „American Guinea Pig: Bouquet of Guts and Gore“ perfekt in das vorsätzlich schäbige Gesamtbild der Reihe. Gefilmt wurde auf VHS und 8-Milimeter[1], mit zahlreichen Bildstörungen, sekundenlangen Aussetzern und ohne jeglichen Kunstanspruch, was dem unerfreulichen Geschehen einen überaus unangenehmen Hauch von (Pseudo-)Realismus verleiht.
Gewissermaßen haben wir hier also geradezu prototypischen Videothekenschrott vorliegen, ein aus Gewinnsucht schäbig hingewichstes Nichts, von Geschäftemachern, die Splatterfans ohnehin für anspruchslose Vollhorste halten, denen man mit ein wenig Gesäge und Gedärm das Geld aus der Tasche locken kann. Unterm Strich ist der Film jedenfalls so derartig öde, dass Zuschauer mit unempfindlichem Magen bequem alles Mögliche nebenbei erledigen können. Dass einen das blutige Geschehen relativ kalt lässt ist allerdings eine unvermeidbare Schwachstelle solcher Fake-Snuff-Movies. Ohne eine Einführung der Charaktere und ohne dramatische Entwicklungen bleibt die Spannungskurve zwangsläufig flach, eine Identifikation mit den Figuren kann nicht stattfinden, stattdessen sind die Opfer einfach nur Körper, mit denen man unappetitliche Dinge anstellt.
Und schließlich die zynische Schlußpointe (Achtung Spoiler!):
Mit Blick auf das endlos ausgewalzte und überaus anstrengend anzuschauende Martyrium zuvor kann man nur dankbar dafür sein, dass „American Guinea Pig“ an dieser Stelle gnädig abbricht, andererseits läuft danach die Assoziationskette im Gehirn munter weiter und ich denke, dass man schon sehr abgebrüht sein muss, wenn einem danach der Filmabend nicht gründlich versaut wurde. Allerdings auf eine schwer in Worte fassbare, letztlich dann doch positiv zu bewertende Art und Weise, denn im Grunde genommen dreht der Film durch diesen Plottwist seine gesamte vordergründig entfaltete Intention wieder um.
Das Ende hingegen signalisiert einerseits, dass die Macher vor nichts haltmachen und auch noch die letzten Tabus brechen, zwingt den Konsumenten aber gleichzeitig zum Nachdenken darüber, ob man gewissermaßen als Komplize (als Zuschauer steckt man ja ohnehin immer ein Stück weit mit den Bösewichten unter einer Decke) diesen Weg mit beschreiten würde. Dadurch hat „American Guinea Pig“ bei aller Modernität dann doch auch wieder viel mit dem klassischen Horror gemeinsam, denn letztlich verarbeitet er das Motiv des „verbotenen Wissens“ bzw. des Unaussprechlichen und Undenkbaren, und stellt abschließend die Frage, wann genug ist[2].
Andererseits kann aber von einer Gewaltverherrlichung keine Rede sein. Die Gewalt wird vielmehr völlig sinnentleert und ohne Subtext „neutral“ vorgeführt, ohne sie stilistisch zu überhöhen. Im Gegenteil wird der gewaltpornographische Kontext sogar noch dadurch gebrochen, dass der „Regisseur“ mehrfach betont, der ausführende Folterknecht solle ihn gefälligst heißmachen, wodurch deutlich wird, dass man ebenso bösartigen wie erbärmlichen emotionalen Krüppeln bei der sexuellen Ersatzhandlung zusieht. Auffallend oft wird darum auch mit den Fingern in diversen künstlich verursachten Körperöffnungen herumgepuhlt oder mit eindeutigen Handbewegungen ein freigelegtes Herz massiert.
Ein Film, der seinen Zeigegestus so offen ausreizt wird es allerdings immer schwer haben solange der Paragraph 131 eine Geschmackszensur ermöglicht. Dass er jetzt trotz der ausschließlich in Österreich erfolgten deutschen Veröffentlichung offiziell vom Markt genommen wurde wird ohnehin nur bewirken, dass die Nachfrage und auch der Sammlerwert dieses fiesen kleinen Drecksfilms ansteigen wird, obwohl er das eigentlich gar nicht verdient hat. Denn beklemmender Schluss hin oder her – „American Guinea Pig: Bouquet of Guts and Gore“ ist im Kern billiger Schund. Nur eben billiger Schund, der frech genug ist, die Konsumenten darauf hinzuweisen, dass das wechselseitige Spiel aus Schaulust und schmuddeliger Zurschaustellung irgendwann auch mal ein Ende haben sollte. Also nach der fünften oder sechsten Fortsetzung, wenn Unearthed Films mit „Bloodshock“, „The Song of Solomon“ und was da sonst noch so kommen mag, genug Kohle gescheffelt hat.
Alexander [1] Grüße an Nicholoas Cage [2] Es dürfte darum auch kein Zufall sein, dass im Abspann u. a. Lovecraft’s Großen Alten gedankt wird.
|
||||||||||||
- Hauptkategorie: Film
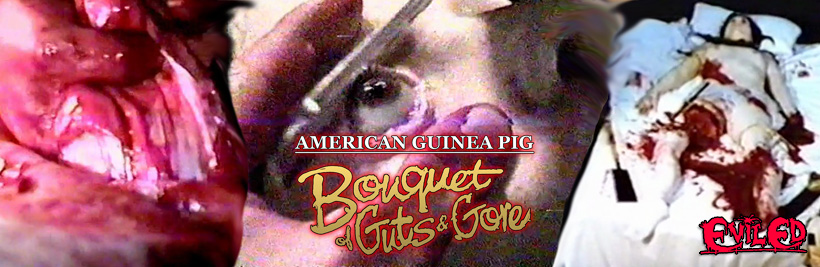



 Vor allem weil die Spezialeffekte im oberen Bereich anzusiedeln sind bzw. durch unprofessionelle Ausleuchtung und die miese Bildqualität viel kaschiert werden kann, funktioniert „American Guinea Pig“ in seiner Summe also tatsächlich so, als ob ein paar bösartige Spinner in ihrem Hobbykeller einen Snuff-Film gedreht hätten. Und da es bei so etwas nicht um filmkünstlerische Mätzchen wie elaborierte Bildsprache, Dramaturgie oder geschliffene Dialoge geht, muss man den Hut davor ziehen, dass dieser Reduktionismus konsequent durchgezogen wird und der Film über den Großteil der Laufzeit nichts anderes zeigt als die Zerstörung zweier (selbstverständlich!) weiblicher Körper. Sehr stimmig ist in diesem Zusammenhang darüber hinaus, dass die Snuff-Filmer nicht nur keine Ahnung von Kameraführung haben, sondern auch bei der Zerlegerei nicht gerade professionell agieren. Das Absägen eines Beins oder die Öffnung des Brustkorbs wird dabei zur harten und anstrengenden Arbeit, der Film in seiner Gesamtheit zu einer endlosen Quälerei, die einem bedeutend länger vorkommt als die tatsächliche Laufzeit von 72 Minuten.
Vor allem weil die Spezialeffekte im oberen Bereich anzusiedeln sind bzw. durch unprofessionelle Ausleuchtung und die miese Bildqualität viel kaschiert werden kann, funktioniert „American Guinea Pig“ in seiner Summe also tatsächlich so, als ob ein paar bösartige Spinner in ihrem Hobbykeller einen Snuff-Film gedreht hätten. Und da es bei so etwas nicht um filmkünstlerische Mätzchen wie elaborierte Bildsprache, Dramaturgie oder geschliffene Dialoge geht, muss man den Hut davor ziehen, dass dieser Reduktionismus konsequent durchgezogen wird und der Film über den Großteil der Laufzeit nichts anderes zeigt als die Zerstörung zweier (selbstverständlich!) weiblicher Körper. Sehr stimmig ist in diesem Zusammenhang darüber hinaus, dass die Snuff-Filmer nicht nur keine Ahnung von Kameraführung haben, sondern auch bei der Zerlegerei nicht gerade professionell agieren. Das Absägen eines Beins oder die Öffnung des Brustkorbs wird dabei zur harten und anstrengenden Arbeit, der Film in seiner Gesamtheit zu einer endlosen Quälerei, die einem bedeutend länger vorkommt als die tatsächliche Laufzeit von 72 Minuten.
 „American Guinea Pig“ treibt diese zusätzliche emotionale Distanz sogar noch dadurch auf die Spitze, dass den beiden Frauen irgendwelche Mittelchen verabreicht werden, die die Muskulatur lähmen, weshalb sie nicht kreischen und zappeln sondern einfach nur katatonisch daliegen. Mit Blick aufs Geld dürfte diese Idee natürlich zunächst einmal die technische Ausführung der diversen Amputations- und Verstümmelungseffekte vereinfacht haben, und auf den ersten Blick wirkt durch die Ruhe der Opfer auch alles gar nicht so schlimm, aber: wenn man berücksichtigt, dass das Schmerzempfinden nicht ausgeschaltet wurde und die Frauen im Grunde genommen bei vollem Bewußtstein eine Vivisektion (mit kleinen Dreingaben wie Kieferbruch und in der Augenhöhle ausgedrückter Zigarette) über sich ergehen lassen müssen, dann schleicht sich bei aller Distanz zum Geschehen, bei der gähnenden Frage danach, wie lange die Jungs denn noch so weiterschnibbeln wollen, doch wieder das pure Grauen durch die Hintertür ein und die quälende Monotonie der Folter macht Sinn.
„American Guinea Pig“ treibt diese zusätzliche emotionale Distanz sogar noch dadurch auf die Spitze, dass den beiden Frauen irgendwelche Mittelchen verabreicht werden, die die Muskulatur lähmen, weshalb sie nicht kreischen und zappeln sondern einfach nur katatonisch daliegen. Mit Blick aufs Geld dürfte diese Idee natürlich zunächst einmal die technische Ausführung der diversen Amputations- und Verstümmelungseffekte vereinfacht haben, und auf den ersten Blick wirkt durch die Ruhe der Opfer auch alles gar nicht so schlimm, aber: wenn man berücksichtigt, dass das Schmerzempfinden nicht ausgeschaltet wurde und die Frauen im Grunde genommen bei vollem Bewußtstein eine Vivisektion (mit kleinen Dreingaben wie Kieferbruch und in der Augenhöhle ausgedrückter Zigarette) über sich ergehen lassen müssen, dann schleicht sich bei aller Distanz zum Geschehen, bei der gähnenden Frage danach, wie lange die Jungs denn noch so weiterschnibbeln wollen, doch wieder das pure Grauen durch die Hintertür ein und die quälende Monotonie der Folter macht Sinn.
 Hätte man es bei der Zerstörung der zwei Frauen belassen, dann wäre „American Guinea Pig“ einfach nur ein zynisches Spiel mit der Schaulust, mit der Neugier vorrangig männlicher Konsumenten auf weibliches Fleisch, mit einem Wort: strunzdumme Gewaltpornographie (okay, erwischt, das waren jetzt zwei Worte). Das soll nicht heißen, dass die Simulation einer Folterung völlig reizlos ist, tatsächlich bietet sich ja hier bereits ein Diskurs über die Grenzen des Zeigbaren, über gnadenlosen Kapitalismus bzw. den zum Humankapital im schlimmsten Sinne erniedrigten Menschen an (auch wenn die Existenz von Snuff-Filmen meines Wissens noch nicht nachgewiesen wurde ist davon auszugehen, dass es genügend Menschen gibt, die kaputt genug sind, derlei zu produzieren bzw. zu konsumieren). D. h., auch ohne den Schluss bieten sich viele Anknüpfungspunkte zur Reflexion darüber, was mit einer Gesellschaft nicht stimmt, in der sich mit solchen Filmen Geld verdienen lässt.
Hätte man es bei der Zerstörung der zwei Frauen belassen, dann wäre „American Guinea Pig“ einfach nur ein zynisches Spiel mit der Schaulust, mit der Neugier vorrangig männlicher Konsumenten auf weibliches Fleisch, mit einem Wort: strunzdumme Gewaltpornographie (okay, erwischt, das waren jetzt zwei Worte). Das soll nicht heißen, dass die Simulation einer Folterung völlig reizlos ist, tatsächlich bietet sich ja hier bereits ein Diskurs über die Grenzen des Zeigbaren, über gnadenlosen Kapitalismus bzw. den zum Humankapital im schlimmsten Sinne erniedrigten Menschen an (auch wenn die Existenz von Snuff-Filmen meines Wissens noch nicht nachgewiesen wurde ist davon auszugehen, dass es genügend Menschen gibt, die kaputt genug sind, derlei zu produzieren bzw. zu konsumieren). D. h., auch ohne den Schluss bieten sich viele Anknüpfungspunkte zur Reflexion darüber, was mit einer Gesellschaft nicht stimmt, in der sich mit solchen Filmen Geld verdienen lässt.
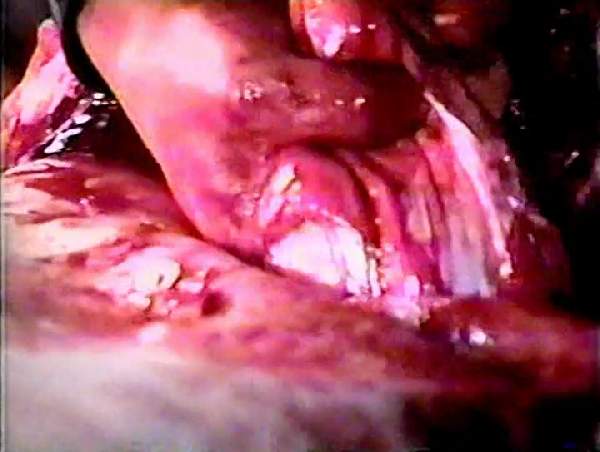 Da diese Handlungen aber keine Wiedergabe realer Vorgänge, sondern inszeniert sind (was man durch den Pseudorealismus, insbesondere auch durch den Umstand, dass „Regisseur“ und Kamerateam ständig sichtbar sind, leicht vergessen kann), greift letztlich nicht einmal mehr der Vorwurf der Menschenverachtung. Denn menschenverachtend agiert nur das von Schauspielern verkörperte fiktive Filmteam, nicht hingegen das off-screen bleibende tatsächliche Team um Stephen Biro, und es ist reichlich beschränkt, anhand von Kunstfiguren Rückschlüsse auf die Intention ihrer Urheber zu ziehen.
Da diese Handlungen aber keine Wiedergabe realer Vorgänge, sondern inszeniert sind (was man durch den Pseudorealismus, insbesondere auch durch den Umstand, dass „Regisseur“ und Kamerateam ständig sichtbar sind, leicht vergessen kann), greift letztlich nicht einmal mehr der Vorwurf der Menschenverachtung. Denn menschenverachtend agiert nur das von Schauspielern verkörperte fiktive Filmteam, nicht hingegen das off-screen bleibende tatsächliche Team um Stephen Biro, und es ist reichlich beschränkt, anhand von Kunstfiguren Rückschlüsse auf die Intention ihrer Urheber zu ziehen.