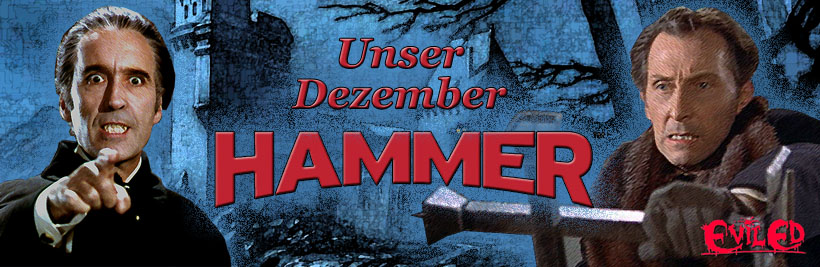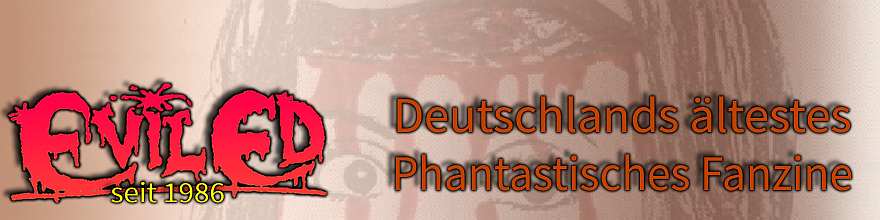|
(GB 1966)
Regie: John Gilling Drehbuch: Peter Bryan Darsteller: André Morell, Diane Clare, Brook Williams, Michael Ripper
Allerdings bleibt John Gillings an den gleichen Drehorten und weitgehend in den selben Sets wie „The Reptile“ (beide Filme wurden simultan gedreht, weshalb Jaqueline Pearce und Michael Ripper ebenfalls wieder mit von der Partie sind) entstandene „The Plague of the Zombies“ noch ganz in der Tradition des Voodoo-Glaubens verhaftet und bildet somit auch inhaltlich ein reizvolles Gegenstück zur etwas später im gleichen Jahr veröffentlichten Mär von der Schlangenfrau. Denn hüben wie drüben sind aus den Kolonien importierte (Un-)Sitten für allerlei unheimliche Vorkommnisse im beschaulichen Cornwall verantwortlich, gewissermaßen rächen sich die einstmals Ausgebeuteten nun am Empire, indem sie die typische britische Steifheit mit ausgelassener Sexualität konfrontieren.
Das ruft seinen Doktorvater Sir James Forbes (André Morell) auf den Plan, der gemeinsam mit seiner Tochter, dem Arzt und einem freundlichen Polizeisergeanten (M. Ripper) gleich soviel Licht ins Dunkel bringt, dass auch in diesem Film am Ende die Hütte niederbrennt. Hinter dieser im Direktvergleich mit den Italienern noch sehr vornehm bleibenden Zombieplage steckt übrigens ein feiner Herr namens Clive Hamilton (John Carson). Dieser hat sich einige Zeit lang in Haiti herumgedrückt, ist dort vermutlich bei Murder Legendre zur Schule gegangen und weil er sich zum Arbeiten zu schade ist versklavt er nun die armen Dörfler, damit diese als Untote in seinem Bergwerk schuften. Wodurch die Verortung der Handlung in der für Hammerfilme üblichen Zeit irgendwann kurz nach der Industrialisierung[1] nicht nur für die gewohnt opulente Ausstattung sorgt, sondern im Zusammenhang mit der Sozialen Frage durchaus Sinn macht, geht es im Kern doch um das Elend der Proletarier, die durch den technologischen Wandel, den Dampfmaschine und Spinning Jenny mit sich brachten, zu entfremdeter Arbeit genötigt bzw. zum Humankapital degradiert werden. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang ebenfalls, dass Gilling auch in diesen Film zahlreiche kleinere Anspielungen auf den gesellschaftlichen Wandel der 60er Jahre einstreut. Zwar ist die Tochter von Professor Forbes noch nicht ganz so emanzipiert wie die Frau von Captain Spalding, und unterm Strich bleiben die Frauen in der „Plague…“ generell auf die Opferrolle beschränkt, doch deutet sich ein neues Selbstverständnis der Frau immerhin bereits im lockeren Umgang mit ihrem Vater an, wenn sie mit sichtlichem Spaß an der Ironie die Ernsthaftigkeit des professoralen alten Mannes konterkariert. Zumal die beiden Akademiker etwas später beim Geschirrspülen sogar die Teller zerdeppern und das Töchterlein obendrein auch noch eine Parforcegesellschaft in die falsche Richtung lotst, damit dem Fuchs nichts geschieht (Tierschutz wird auch in „The Reptile“ angesprochen, in „Plague…“ wird dieses Thema allerdings direkt mit einem Angriff auf die Tradition verbunden; die Parforcejagd sorgte lange für Kontroversen und ist in Großbritannien erst seit 2005 verboten).
Im Doppelpack mit „The Reptile“ ergibt sich jedenfalls ein stimmungsvoller Filmabend, denn durch die inhaltlichen Überschneidungen und Abweichungen, bekannte Handlungsorte und Gesichter im veränderten Kontext, pflegen die beiden Filme gewissermaßen eine eigenwillige Kommunikation miteinander, ohne dass man hinterher sagen könnte, welcher denn jetzt besser war.
[1] Anmerkung: Großbritannien war in der viktorianischen Zeit, die den historischen Hintergrund der meisten Hammer-Filme bildet, zwar bereits weitgehend industrialisiert, Gebiete wie Cornwall waren allerdings gesellschaftlich ziemlich rückständig, ein Squire wie Hamilton hatte noch nahezu unumschränkte Macht und sogar Zinnminen gab es dort (nebst häufigen Unfällen). [2] Whitehead, Henry S.: West India Lights, Sauk City 1946 Alexander
|
|||||||||||
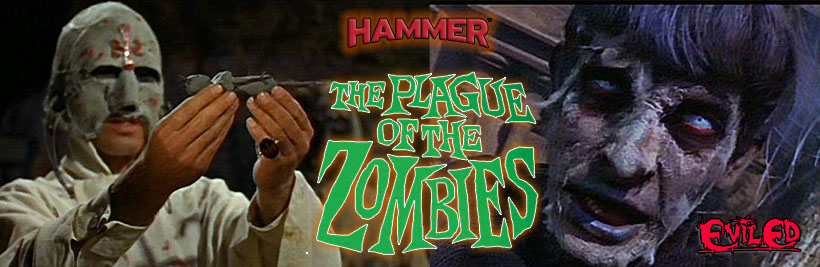


 Vorher erheben sich aber die Toten aus den Gräbern und nehmen in ihren Kutten Fulcis „Zombi 2“ und seine italienischen Epigonen vorweg, auch wenn das Makeup nicht ganz so drastisch daherkommt.
Vorher erheben sich aber die Toten aus den Gräbern und nehmen in ihren Kutten Fulcis „Zombi 2“ und seine italienischen Epigonen vorweg, auch wenn das Makeup nicht ganz so drastisch daherkommt. Und anders als in „The Reptile“ verwässert Gilling diesen ziemlich marxistischen Ansatz nicht einmal damit, dass schließlich doch noch kolonialistische Feindbilder bemüht werden, vielmehr stützt der Umstand, dass ein britischer Gentleman der Bösewicht ist sogar die von Henry S. Whitehead in seinem Essay „Obi in the Carribean“ formulierte These, wonach der Zombie-Aberglauben von den Kolonialmächten erfunden oder zumindest tatkräftig gefördert wurde, um die indigene Bevölkerung der Westindischen Inseln mit einem vielseitig verwendbaren Butzemann im Schach zu halten.
Und anders als in „The Reptile“ verwässert Gilling diesen ziemlich marxistischen Ansatz nicht einmal damit, dass schließlich doch noch kolonialistische Feindbilder bemüht werden, vielmehr stützt der Umstand, dass ein britischer Gentleman der Bösewicht ist sogar die von Henry S. Whitehead in seinem Essay „Obi in the Carribean“ formulierte These, wonach der Zombie-Aberglauben von den Kolonialmächten erfunden oder zumindest tatkräftig gefördert wurde, um die indigene Bevölkerung der Westindischen Inseln mit einem vielseitig verwendbaren Butzemann im Schach zu halten. Weniger marxistisch als vielmehr vulgärfreudianisch hingegen gerät schließlich der Nebenplot um die Rettung der blonden Unschuld aus den Klauen des barbarischen Ritus: denn selbstverständlich gedenkt Hamilton, seine Untaten durch ein Menschenopfer zu krönen, das überdeutlich als sexuelle Ersatzhandlung inszeniert wird. Wenn der Mensch erstmal zum bloßen Objekt erniedrigt wird ist es allerdings nur folgerichtig, dass das solcherart entstandene Material nicht nur als Arbeitskraft missbraucht wird sondern auch im Wortsinne, weshalb das genüssliche Zücken des Dolches und die gründliche Überprüfung der Klingenschärfe gut ins Gesamtbild passen. Und dass dieser „Opferung“ auch noch das „erste Blut“ vorangeht (Tochter schneidet sich in Anwesenheit von Hamilton an einem zerbrochenen Glas in die Finger) versteht sich von selbst.
Weniger marxistisch als vielmehr vulgärfreudianisch hingegen gerät schließlich der Nebenplot um die Rettung der blonden Unschuld aus den Klauen des barbarischen Ritus: denn selbstverständlich gedenkt Hamilton, seine Untaten durch ein Menschenopfer zu krönen, das überdeutlich als sexuelle Ersatzhandlung inszeniert wird. Wenn der Mensch erstmal zum bloßen Objekt erniedrigt wird ist es allerdings nur folgerichtig, dass das solcherart entstandene Material nicht nur als Arbeitskraft missbraucht wird sondern auch im Wortsinne, weshalb das genüssliche Zücken des Dolches und die gründliche Überprüfung der Klingenschärfe gut ins Gesamtbild passen. Und dass dieser „Opferung“ auch noch das „erste Blut“ vorangeht (Tochter schneidet sich in Anwesenheit von Hamilton an einem zerbrochenen Glas in die Finger) versteht sich von selbst. Wenn man überhaupt zu einer Wertung kommt, dann vielleicht, dass „The Plague of the Zombies“ temporeicher ist und vieles vorwegnimmt, was später zur Standardzutat eines jeden Zombiefilms werden sollte. Insbesondere die Auferstehungssequenz (die hier allerdings nur als Alptraum stattfindet) mit den schiefen Kameraeinstellungen ist hier hervorzuheben, aber auch die brennenden Zombies oder die für einen vor dem Losrollen der Splatterwelle entstandenen Film bemerkenswerte Härte – bereits hier gibt es eine Köpfung mit dem Spaten zu sehen – wurden später immer wieder zitiert. Und allzu häufig ohne John Gillings formales Geschick im Erschaffen einer schaurig-schönen Gruselatmosphäre.
Wenn man überhaupt zu einer Wertung kommt, dann vielleicht, dass „The Plague of the Zombies“ temporeicher ist und vieles vorwegnimmt, was später zur Standardzutat eines jeden Zombiefilms werden sollte. Insbesondere die Auferstehungssequenz (die hier allerdings nur als Alptraum stattfindet) mit den schiefen Kameraeinstellungen ist hier hervorzuheben, aber auch die brennenden Zombies oder die für einen vor dem Losrollen der Splatterwelle entstandenen Film bemerkenswerte Härte – bereits hier gibt es eine Köpfung mit dem Spaten zu sehen – wurden später immer wieder zitiert. Und allzu häufig ohne John Gillings formales Geschick im Erschaffen einer schaurig-schönen Gruselatmosphäre.